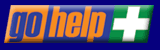
| · |
|
|
|
|
||
|
Startseite » Statistik |
|
||
|
Statistik
zur Ersten Hilfe besteht nicht nur aus Zahlen über Unfälle und Todesursachen, sondern umfasst auch Analysen zum Verhalten in Notsituationen. Wir greifen zur Darstellung auf amtliche Veröffentlichungen der statistischen Bundes- und Landesbehördern zu und verwenden Ergebnisse eigener Untersuchungen.
Demographie, Altersstruktur der Bevölkerung und Erste Hilfe
Der Begriff von der Überalterung der Gesellschaften geistert schon seit einigen Jahren durch die Medien, meist in Bezug auf die sozialen Sicherungssysteme, also die Renten. Überaltererung meint dabei ein Missverhältnis zwischen alten und jungen Menschen - Missverhältnis deshalb, weil den alten (nicht mehr arbeitenden) immer weniger junge (arbeitende und damit in die Rentenversicherung einzahlende) Menschen gegenüberstehen. Es wird also durch die Alten Geld aus einem Topf verbraucht, der von den wenigen Jungen nicht mehr aufgefüllt werden kann. Wo das hinführt, wird sich zeigen. Entwicklungen der Bevölkerungsstruktur, hinsichtlich Alter, Geschlecht usw. bezeichnet man als Demographie. Bekanntestes Beispiel für demographische Daten ist die Alterspyramide (oder Altersbaum, Abb. 1, 2).
Die linke Hälfte stellt den Anteil der Männer, die rechte den der Frauen dar. Trotz der niedrigen Auflösung kann man erkennen, dass es mehr alte Frauen gibt, was sich aus der höheren Lebenserwartung dieses Geschlechts ergibt. Die Ausdehnung zur Seite gibt für jedes Alter die exakte „Menge” an Menschen an. Ganz unten, auf der Grundlinie finden sich die Neugeborenen eines Jahres, an der Spitze der Pyramide die mehr als 100-Jährigen. Die Statistiker wissen über die Altersentwicklung in einer Bevölkerung schon sehr früh und sehr genau Bescheid, so reichen die heute verfügbaren Zahlen bis über das Jahr 2050 hinaus. Nachdem diese Untersuchungen nicht erst seit gestern gemacht werden, könnten wir uns fragen, warum den Problemen der Überalterung nicht schon früher durch Anpassung der Sozialsysteme entgegengewirkt wurde. Aber in der großen Politik ist wohl vieles so wie im Kleinen bei uns, und wen interessiert schon wirklich, wie viel Geld er in 50 Jahren zum Essen haben wird?
Mit jedem Jahr, das vergeht, wandert die Pyramide eine Stufe nach oben. Das bedeutet, dass bei anhaltend stagnierender (=auf niedrigem Stand verharrender) Geburtenzahl die Bevölkerung abnimmt, da die weiter oben befindlichen Jahrgänge irgendwann sterben und von unten nicht mehr so viel nachkommt. Bei inzwischen sieben Milliarden (7.000.000.000) Menschen auf der Erde und den daraus folgenden Problemen (Mangelernährung, Übernutzung von Bodenschätzen usw.) könnte uns diese Entwicklung doch entgegenkommen - oder? Die beiden abgebildeten Alterspyramiden (und das Phänomen des Geburtenrückganges) gelten verallgemeinert nur für hoch-industrialisierten Länder. In Entwicklungsländern sehen diese Pyramiden vollkommen anders aus. Die Lebenserwartung ist deutlich geringer, zum Teil endet die Pyramide bei 50 Jahren, älter wird dort kaum jemand. Und dennoch ist die Geburtenzahl so hoch, eben höher als die Gesamtsterblichkeit, dass die Gesamtbevölkerung der Erde weiter zunimmt. Erste Hilfe. Auch auf die Erste Hilfe wirkt sich die älter werdende Bevölkerung aus. Es ist ein Segen der modernen Medizin und „zuliefernder” Wissenschaften, dass die Lebensumstände (bei uns!) so gut sind, dass wir immer älter werden. 100 Lebensjahre sind keine Seltenheit. Mit zunehmendem Alter nehmen aber auch Störungen der Organismus zu. Eigentlich logisch, gibt es doch „Bauteile” in unserem Körper, die niemals ausgetauscht oder erneuert werden (Gehirn, Nervenzellen) oder die niemals eine Verschnaufpause einlegen können (Herz). Irgendwann ist ein Organismus alt. Sind wesentliche, für das Überleben wichtige Funktionen betroffen, dann sterben einzelne Zellen, greift der Untergangsprozess weiter Raum, dann sterben Gewebe, schließlich stirbt das große Ganze. Das große Ganze ist der Mensch, mit all seinen individuellen Fähigkeiten, seiner Persönlichkeit, seinen Wünschen, Erinnerungen und Beziehungen. Das Sterben ist ein komplexer Prozess. Den Zeitpunkt, wann es an der Zeit für uns ist, können wir nicht bestimmen. Zu vielfältig ist das Leben mit seinen Gefahren (aber natürlich auch dem Glück). Jeder wird die Geschichten kennen, von dem „Onkel, der jeden Tag 100 Zigaretten geraucht hat, und doch 100 Jahre alt geworden ist”, andererseits die Menschen, die „immer gesund gelebt haben, und plötzlich, aus heiterem Himmel vom Schlag getroffen wurden” (Was auch immer das für eine Todesursache sein soll). Glücklich diejenigen, die ein erfülltes Leben führen können und sich unter dem Eindruck des nahen Endes von ihrer Welt verabschieden können. Ein Unfall oder eine akute Erkrankungen lässt dies jedoch nicht zu, daher kommt unter Umständen uns Ersthelfern die Aufgabe zu, den Zeitpunkt des Todes hinauszuzögern. Versuchen sollten wir es in jedem Fall.
1 Den Begriff Selbstmord verwenden wir trotz der Diskussionsmöglichkeit, dass Mord eine vorsätzliche Handlung gegen das Leben eines anderen darstellt. Der neutralere Begriff „Selbsttötung” ist aber geeignet, den Umstand zu verschweigen, dass unter der Handlung, die dem eigenen Leben ein Ende setzt, andere Menschen tatsächlich leiden. Dies können Angehörige sein, aber selbst der heimlichste Tod wird in unserer zivilisierten Gesellschaft Menschen betreffen, z.B. Rettungsdienst.
Kommentar zur Todesursachenstatistik Italien findet sich, entgegen den „Vorurteilen” in der Bevölkerung der nördlichen Nachbarländer am Ende der Unfallstatistik. Die vielfach beschworene lockere Lebensart, die sich auch in einer - nun ja, unkonventionellen - Fahrweise äußert, führt zu deutlich mehr Verkehrstoten, als in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Restriktive Maßnahmen, Kontrollen von Geschwindigkeit und Sicherungspflichten (Gurt, Helm), haben die Unfallschwere dort weit abgesenkt. Einem Kommentar noch nicht so recht zugänglich ist die Überlegung, dass gerade in den südlichen Provinzen Italiens die Verwendung von Gurt und Helm nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Dies ist eine Vermutung. Wenn dem so wäre, wäre das Risiko, Unfallopfer zu werden, in Süditalien höher, als in Norditalien. Solch ein Umstand müsste natürlich zum Positiven hin verändert werden - entsprechende Verkehrssicherheitskampagnen in Italien scheinen vielversprechend zu sein, vor allem, weil sie sich nicht zu einem reinen Vorschriften-Vortrag versteigen, sondern die eventuell ursächliche Lebenseinstellung berücksichtigen. Diese Lebensart könnte in den gleichen Provinzen zu einer niedrigeren Erkrankung und Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, da die Ernährungsweise dort ausgewogener sein könnte (sog. Mittelmeer-Küche). Viele (vorzeitige) Todesfälle könnten bei Beachtung von Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden. Fahrzeuge sind heute sehr sicher, doch wer sich nicht angurtet, dem hilft auch der Airbag nichts. Erhöhter Blutdruck ist heute als Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall bekannt, doch man muss einem Bluthochdruck auch entsprechend begegnen, durch Reduzierung überflüssiger Nahrungsstoffe (Fette, Zucker) und vermehrte Bewegung. Vorbeugung kann so einfach sein: einfach nicht rauchen, einfach keinen Alkohol trinken, einfach einen Gurt anlegen, einfach einen Helm aufsetzen, auch beim Fahrradfahren. Und doch fällt das Einfache oft schwer: es wird schon nichts passieren, wenn ich heute mal ohne Helm; noch diese eine Zigarette; nach diesen paar Bieren kann ich schon noch Auto fahren usw.
Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Gefäßerkrankungen)
2 „Ischämie” bedeutet: Blutleere durch Minderung der Blutzufuhr; stammt von grch. ischaimos: blutstillend (dies wiederum von grch. ischein: stocken und grch. haima (oder: häm, oder: äm (wie bei Hämatom)). Ischämische Herzkrankheiten sind Krankheiten in denen die Blutzufuhr v. a. zum Herzmuskel selbst nicht mehr verstopfungsfrei funktioniert, wie bei der Angina pectoris, koronaren Herzkrankheit (KHK) u. a. 3 „Krankheiten der hirnversorgenden Gefäße”: Dies ist in erster Linie der Schlaganfall, aber auch manche Form der Hirnblutung 4 andere Herzkrankheiten sind z.B. durch angeborene Herzfehler bedingt
Herz-Kreislauf-Krankheiten stellen den größten Teil der Todesfälle, gemittelt über alle Altersklassen. Würde man die Tabelle 1 weiter verfeinern, dann stellte sich heraus, dass beispielsweise in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen der Unfalltod eine herausragende Rolle spielt. Eben dort liegen auch die Ansätze zur Vermeidung kindlicher Todesfälle, indem Unfallgefahren erkannt und beseitigt werden. Doch nicht nur Kindern passieren Unfälle, auch Erwachsene sind nicht vor ihnen geschützt, nicht einmal am Arbeitsplatz. Obwohl gerade dort strenge Sicherheitsvorschriften gelten, deren Überwachung den gesetzlichen Unfallversicherungen (Unfallversicherungsverbände (AUVA, SUVA) oder Berufsgenossenschaften) obliegt. Die strengen Vorschriften haben bereits zu einer deutlichen Senkung der schweren Arbeitsunfälle geführt, doch sind die Zahlen immer noch sehr hoch, Tab. 3. Außerdem kommt es zu starken Schwankungen (mal mehr, mal weniger Unfälle), die in einigen Arbeitsbereichen durch die Auftragslage bedingt ist usw. Es wäre zu erwarten, dass während der Wirtschaftskrise (2008/2009) die Unfallzahlen in der Industrie rückläufig sind, denn wer nicht arbeitet, kann sich dabei auch nicht verletzen.
Hinzu kommen nochmals viele Millionen Haushalts-, Freizeit- und Sportunfälle. Jeder Unfall stellt eine Belastung der Gesundheitswesen dar, zu den direkten Behandlungskosten (Medikamente, Arzt-, Krankenhauskosten) kommt noch der Arbeitsausfall bei Erwerbstätigen. Daraus sollte sich jeder von uns seine Unfallverhütungsstrategie ableiten: Vorschriften, wie die Gurt- und Helmpflicht, dienen nicht der Schikane, sondern alleine unserem Schutz (zugegeben, dadurch spart sich die Unfallversicherung auch Ausgaben). Wenn Unfallvermeidung einfach ist, sollten wir es einfach tun: Langsam fahren, Abstand halten, nicht drängeln, Helm tragen, Gurt anlegen, nicht bei Rot über die Straße gehen usw. Vor allem für Kinder müssen wir Vorbilder sein, da diese vermeintlich sicheres Verhalten kopieren und nicht zwischen harmlosen und gefährlichen Situationen unterscheiden können. Das bedeutet, dass wir an einer roten Ampel immer stehen bleiben müssen, wenn Kinder dabei oder in der Nähe sind, selbst wenn wir (alleine) bei (scheinbar) geringem Risiko uns darüber hinwegsetzen würden.
Demnächst gibt es hier mehr Statistik zur Ersten Hilfe.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2009 Deutsche Gesellschaft für Erste
Hilfe · Version 7.1.07 (Juni 2009) |