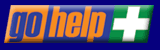
| · |
|
|
|
|
||
|
Startseite » Erste Hilfe » Unfälle » Wundversorgung » Schürfwunden |
|
||
|
Schürfwunden
Bei Schürfwunden (Abschürfungen, Fachausdrücke: Erosion, Exfoliation, Exkoriation) ist nur die oberste Hautschicht (Oberhaut, Fachausdruck: Epidermis, Abb.1) verletzt. Schürfwunden passieren schnell, sind aber in der Regel harmlos und verheilen ohne Narbenbildung. Aber auch kleinste Schürfwunden können eine Eintrittspforte für Krankheitserreger sein.
Deshalb ist eine Schutzimpfung gegen den Erreger des Wundstarrkrampfs (Tetanus) ratsam, zusätzlich sollte eine Wunde bis zu ihrer endgültigen Heilung immer genau beobachtet und bei Auftreten von Schmerzen, Rötung, Schwellung oder Erwärmung (siehe unter „Gefahren”) ein Arzt aufgesucht werden.
Funktion der Haut und Schürfverletzungen
Bei Schürfwunden wird die oberste Hautschicht (Epidermis) verletzt. Diese enthält freie Nervenendigungen, die Schmerzempfindungen weiterleitet. Deshalb empfindet man bei Schürfverletzung Schmerzen. Die Epidermis besteht an ihrer Oberfläche aus verhornten, äußerst widerstandsfähigen Zellen, die die Barriere des Körpers gegenüber der Außenwelt darstellt. Diese Hornschicht verhindert das unkontrollierte Verdunsten von Wasser (Abgabe nach außen) und andererseits das Eindringen von Fremdstoffen (Krankheitserreger, chemische Stoffe). Die „Hornzellen” werden von den unteren Schichten der Oberhaut ständig nachgebildet. Es handelt sich um eine Art Fließband, von unten werden die neuen Hornzellen nach oben geschoben und irgendwann abgestoßen (Schuppen, Abb.2). Da die oberste Hautschicht ständig regeneriert (nachgebildet wird), heilen Schürfwunden ohne Narben ab.
Werden bei einer Schürfwunde die kleinsten Blutgefäße verletzt, kommt es zu punktförmigen Blutaustritten. Diese bedürfen keiner Blutstillung, innerhalb kürzestes Zeit kommt es zur Blutstillung. Personen, die „blutverdünnende” Medikamente [Vitamin-K-Antagonisten (Cumarine, z.B. Marcumar®), in geringem Umfang auch bei Thrombozytenaggregationshemmern (Acetylsalicylsäure, ASS)] einnehmen, können selbst bei Schürfverletzungen gelegentlich über eine verlängerte Blutungszeit berichten. Die Verletzung selbst kleinster Blutgefäße stellte eine Eintrittsmöglichkeit für Krankheitserreger dar, im schlimmsten Fall kommt es zur sog. Blutvergiftung (Fachausdruck: Sepsis, siehe unten).
Der Begriff Blutvergiftung bezeichnet im eigentlichen medizinischen Sinn mit dem Vorhandensein von Krankheitserregern im Blut (Sepsis) einen lebensbedrohenden Zustand, der den intensiven Einsatz von Antibiotika erfordert. Im Gegensatz dazu meint der Laie mit Blutvergiftung eine Vorstufe der Sepsis, nämlich die Entzündung von Lymphgefäßen (Lymphangitis, Lymphadenitis). Lymphgefäße sind großteils oberflächlich in der Haut verlaufende Gefäße, die Gewebsflüssigkeit (die sog. Lymphe) zum Blutgefäßsystem (speziell den Venen) zurückführen. Es handelt sich bei der Lymphflüssigkeit um eine Art Abwassersystem, da in der Gewebsflüssigkeit auch Krankheitserreger und andere Fremdstoffe vorhanden sind. In das Lymphsystem eingebaut sind die Lymphknoten. Dabei handelt es sich um Filterstationen, die mit Abwehrzellen besetzt sind und verhindern (sollen), dass Fremdstoffe in das Blutgefäßsystem des Körpers gelangen. Sind aber zu viele z.B. Krankheitserreger in der Lymphflüssigkeit oder vermehren sie sich schnell, dann sind die Lymphknoten überfordert und die Krankheitserreger überwinden die Filter. Gefährlich wird es, wenn die Krankheitserreger ins Blut (die großen Venen) gelangen, denn von da werden sie schnell über das Herz in den gesamten Körper verteilt. Einer Ansiedelung und weiteren Vermehrung steht dann nicht mehr viel im Wege.
Lymphgefäßentzündung erkennen, bevor es zur Blutvergiftung kommt:
Gegen eine Lymphgefäßentzündung kann die Gabe von Antibiotika in Tablettenform notwendig werden, eine „echte” Blutvergiftung (Sepsis) wird immer mit Antibiotika-Infusionen behandelt.
Desinfektion bezeichnet die Verminderung von Keimen (z.B. Bakterien) durch Anwendung v.a. chemischer Stoffe. Als Wund-Desinfektionsmittel kommen in Frage:
Die Hersteller haben sich wegen der unerwünschten Wirkungen der herkömmlichen Desinfektionsmittel (z.B. Brennen, Allergien) auf die Suche nach neuen Wirkstoffen gemacht und solche scheinbar gefunden. Zu den neuen Desinfektionsmitteln gehört das Octenidin, das auch für Schleimhautdesinfektionen zugelassen ist. Für die Wundbehandlung in der Ersten Hilfe sind Desinfektionsmittel aber nicht notwendig und eher teure Spielerei.
Die Anwendung von Desinfektionsmitteln schafft ein trügerisches Gefühl der Sicherheit, deshalb: trotz Desinfektion die Wunde sorgfältig beobachten! Und bei größeren Wunden sollte sowieso ein Arzt aufgesucht werden.
Eine Impfung steht gegen den Erreger des Wundstarrkrampfs (Tetanus) zur Verfügung. Die Tetanus-Schutzimpfung, die im Abstand von 10 Jahren aufgefrischt werden sollte, dringend zu empfehlen. In Deutschland treten Tetanus-Erkrankungen sehr selten auf. Da sich der Erreger (Clostridium tetani) aber überall, auch in Straßenstaub und Erde befindet und es keine wirksame Behandlung gegen eine einmal ausgebrochene Krankheit gibt und diese dann meist tödlich endet, sollten Sie Ihren Impfschutz überprüfen und ggf. auffrischen lassen. Der Impfschutz nach einer Grundimmunisierung (Basisimpfung, bestehend aus 3 Injektionen) hält für ca. 10 Jahre. Wenn ein Mensch einmal in seinem Leben (wie lange das auch immer her sein mag) die drei Impfungen der Grundimmunisierung erhalten hat, dann reicht immer eine einzelne Auffrischimpfung aus, um den Schutz wieder herzustellen.
Gegen andere Krankheitserreger stehen keine Impfungen zur Verfügung. Dazu gehören der Gasbrand (Erreger: Clostridium perfringens) und die Erreger der Blutvergiftung (siehe oben).
Der Inhalt wird erweitert.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1995-2009 Deutsche Gesellschaft für Erste
Hilfe · Version 7.1.07 (März 2009) |