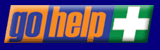|
|
|
|
Sprunggelenksverletzungen
Verletzungen im Sprunggelenk können von einer harmlosen
Verstauchung (lat. Distorsion) bis hin zu Bänderrissen (lat.
Ruptur) und Knochenbrüchen (lat. Fraktur) reichen.
Es ist nicht Aufgabe des Ersthelfers, eine endgültige
Diagnose zu stellen oder über die Notwendigkeit einer ärztlichen
Untersuchung zu entscheiden. In allen Zweifelsfällen sollte einer Verletzung
ein Arztbesuch folgen.
Merke: Eine endgültige Diagnose kann durch den, auch erfahrenen!,
Ersthelfer nicht gestellt werden. Dazu sind bildgebende Verfahren (Röntgen,
MRT, Sonografie) notwendig.
Folgende Zeichen deuten auf eine Verletzung des Sprunggelenks hin:
-
Unfallereignis ("Umgeknickt" usw.)
-
Schmerzen
Die Schmerzen können nach dem Ereignis auch wieder Verschwinden, obwohl eine
ernste Verletzung vorliegt. Deshalb sollte bei nicht rascher,
vollständiger Erholung, wie sie nach einer Bagatellverletzung zu
erwarten wäre, ein Arzt aufgesucht werden.
-
Schwellung
-
Bewegungseinschränkung
Möglicherweise, muss aber nicht vorliegen:
-
Bei einem Sturzereignis immer auch an andere Verletzungen denken:
Kopfverletzungen, Bewusstseinsstörungen.
-
Die Sicherung lebenswichtiger Funktionen hat immer Vorrang
 Notfallmaßnahmen
Notfallmaßnahmen
-
PECH-Regel beachten:
| P |
Pause |
| E |
Eis (Kühlung)* |
| C |
Compression (Druck, z.B. durch Bandage)** |
| H |
Hochlagerung |
(im Englischen gibt es analog
dazu die RICE-Regel: Rest, Ice, Compression, Elevation)
-
Bei Sportlern mit hoher Motivation ("das geht schon, da
kann ich noch weiterspielen") auf die Beendigung des Spiels drängen bzw.
dieses untersagen
-
Ggf.
 Notruf 112
Notruf 112
-
Ggf. weitere Abklärung veranlassen, z.B. in der
Notaufnahme eines Krankenhauses.
* Keine
übertrieben Kühlung! Keine Anwendung von Kühlsprays (Eissprays), da es
zu Erfrierungen der Haut mit gravierenden Folgeschäden kommen kann.
der Haut mit gravierenden Folgeschäden kommen kann.
Bei der Verwendung von Eispacks (Cold-Hot-Pack, Knickbeuteln oder
Eiswürfeln/Eiswasser) darauf achten, dass die Kältequelle nicht direkt
auf der Haut aufliegt. Ein zwischengelegtes Handtuch z.B. schützt sicher vor
Erfrierungen.
** Die Kompression
muss mit elastischen Binden (Kompressionsbinde, meist hautfarben, Abb. 1)
erfolgen, nicht mit starren Tape-Verbänden, da diese die Ausbreitung eines
möglicherweise entstehenden Blutergusses (Hämatom) behindern.
Wenn man es genau nimmt, gibt es nicht ein
Sprunggelenk, sondern zwei, das obere und das untere Sprunggelenk
(Abk. OSG, USG). Durch die enge Nachbarschaft beider Gelenke
und vor allem die Tatsache, dass bei Verletzung fast immer eine Schwellung
und Schmerzen vorliegen, die eine Untersuchung durch den Ersthelfer
unmöglich machen, können wir aber von dem Sprunggelenk
sprechen.
|
Abb. 2
Sprunggelenksknochen |
Unterschenkel- und Fußknochen, aus denen die Sprunggelenke bestehen:
Schienbein (lat. Tibia), Sprungbein (lat. Talus),
Fersenbein (lat. Calcaneus), Kahnbein (lat. Os naviculare).
Auf Röntgenbild (Abb. 2) nur als Aufhellung im Bereich des Schienbeins
zu erkennen ist das Wadenbein (lat. Fibula), da es sich quasi
hinter diesem befindet.
Oberes Sprunggelenk: Verbindung zwischen Schienbein (rot) und
Sprungbein (blau)
Unteres Sprunggelenk: Verbindung zwischen Sprungbein (blau) und
Kahnbein (gelb) |
Gelenke müssen unter teilweise extremen Bedingungen
ihre Funktion erfüllen. Dazu bestehen sie neben den zu verbindenden Knochen
aus Gelenkkapsel und Bändern. In der Gelenkkapsel befindet sich eine
besondere Flüssigkeit (Gelenkschmiere, lat. Synovialflüssigkeit), die
das fast reibungsfreie Gleiten der Gelenkflächen gegeneinander ermöglicht.
Bänder gibt es am Fuß sehr viele, für das obere und
untere Sprunggelenk ist jeweils ein wichtiges in Abb. 3 dargestellt.
|
Abb. 3
Bänder am Fuß |
1 Innenband des oberen,
2 Vorderband des unteren
Sprunggelenks (Abb. 2)
Neben dem Innenband gibt es natürlich auch auf der Außenseite Bänder.
Wenn man sich die Beweglichkeit des Fußes genau betrachtet, dann wird
klar, welch Wunder der Natur wir tagtäglich mit unserem Körpergewicht
belasten. Schäden dieses Gelenks sollten stets ernst genommen werden,
damit die Belastbarkeit erhalten bleibt. |
In Abb. 4 ist der schematische Aufbau eines Gelenks
gezeigt. Die Gelenke des Körpers unterscheiden sich zwar in Details, das
Grundprinzip ist aber stets gleich.
|
In einem Gelenk sind zwei
Knochen (1, 2) miteinander verbunden. Damit Knochen nicht auf Knochen
reibt, sind die Teile des Knochens, die mit dem jeweils anderen
Knochen direkten Kontakt haben (Gelenkflächen) mit Knorpel (3)
überzogen. Knorpel ist ein sehr widerstandsfähiges, extrem glattes
Gewebe. In Verbindung mit der Gelenkschmiere können die Knochen
beinahe reibungslos gegeneinander gleiten.
Die Gelenkkapsel (4) umgibt
das gesamte Gelenk und sorgt dafür, dass die Gelenkschmiere im
Gelenkspalt bleibt. |
Abb. 4 |
Außen- und Innenbänder (5, 7) stabilisieren das Gelenk
und halten es zusammen. Bänder sind äußerst reißfest. Bei einigen Gelenken
(z.B. Kniegelenk) gibt es Hilfsstrukturen, die die Bewegungen in "die
richtigen Bahnen" lenken (Meniskus, 6) oder Schleimhauttaschen (Bursa, 8).
Die endgültige Sicherung der Diagnose (Verstauchung,
Zerrung, Prellung, Bluterguss, Bänderriss, Knochenbruch) kann nur durch
Verbindung folgender Verfahren geschehen:
|
Körperliche Untersuchung |
Die körperliche Untersuchung durch einen unfallchirurgisch,
orthopädisch oder sonstig erfahrenen Arzt ist die Grundlage und stellt
die Weichen für eine zielgerichtete weitere Diagnostik: |
|
Röntgen |
Eine Röntgenaufnahme stellt Knochenstrukturen sehr gut dar;
Bandstrukturen sind nur eingeschränkt beurteilbar.
Sehr geringe Strahlenbelastung. |
|
Computertomografie
(CT) |
Untersuchung mit Röntgenstrahlen, die eine bessere Auflösung von
Knochen- und Bandstrukturen als das normale Röntgen liefert.
Deutlich höhere Strahlenbelastung. |
|
Magnetresonanz-Tomografie = Kernspintomografie (MR, MRT) |
Untersuchung mit sehr hoher Auflösung für Weichteilgewebe, auch
Bänder. Knochen können nur eingeschränkt bzw. gar nicht beurteilt
werden.
Keine Strahlenbelastung, da mit Magnetfeldern gearbeitet wird. |
|
Ultraschall-untersuchung
(Sonografie) |
Mit dem Ultraschall können Weichteilgewebe, z.B. Muskeln, aber auch
Bänder, dargestellt werden. Geringere Aussagekraft als die
Kernspintomografie.
Keine Strahlenbelastung. |
|
Gelenkspiegelung (Arthroskopie) |
Eingreifendste Untersuchungsmethode ist die Gelenkspiegelung. Hierbei
wird ein Endoskop (bei Gelenkuntersuchungen sog. Arthroskop) in
das Gelenk eingeführt. Über einen weiteren Kanal können unmittelbar
Reparaturen durchgeführt werden.
Gelenkspiegelungen können in örtlicher Betäubung (Lokalanästhesie)
oder Vollnarkose erfolgen, stellen aber nicht die erste
Untersuchungsmethode dar. |
Am Sprunggelenk kann sachgerechtes (von erfahrenen
Lehrern erlerntes) Tapen vor der Belastung nützlich sein.
» Mehr zum Tape-Verband erfahren Sie
in Kürze hier!
Bei Fragen stehen wir Ihnen am
 Infotelefon oder per
Infotelefon oder per
 E-Mail gerne zur Verfügung
E-Mail gerne zur Verfügung
|
|
|
|
|